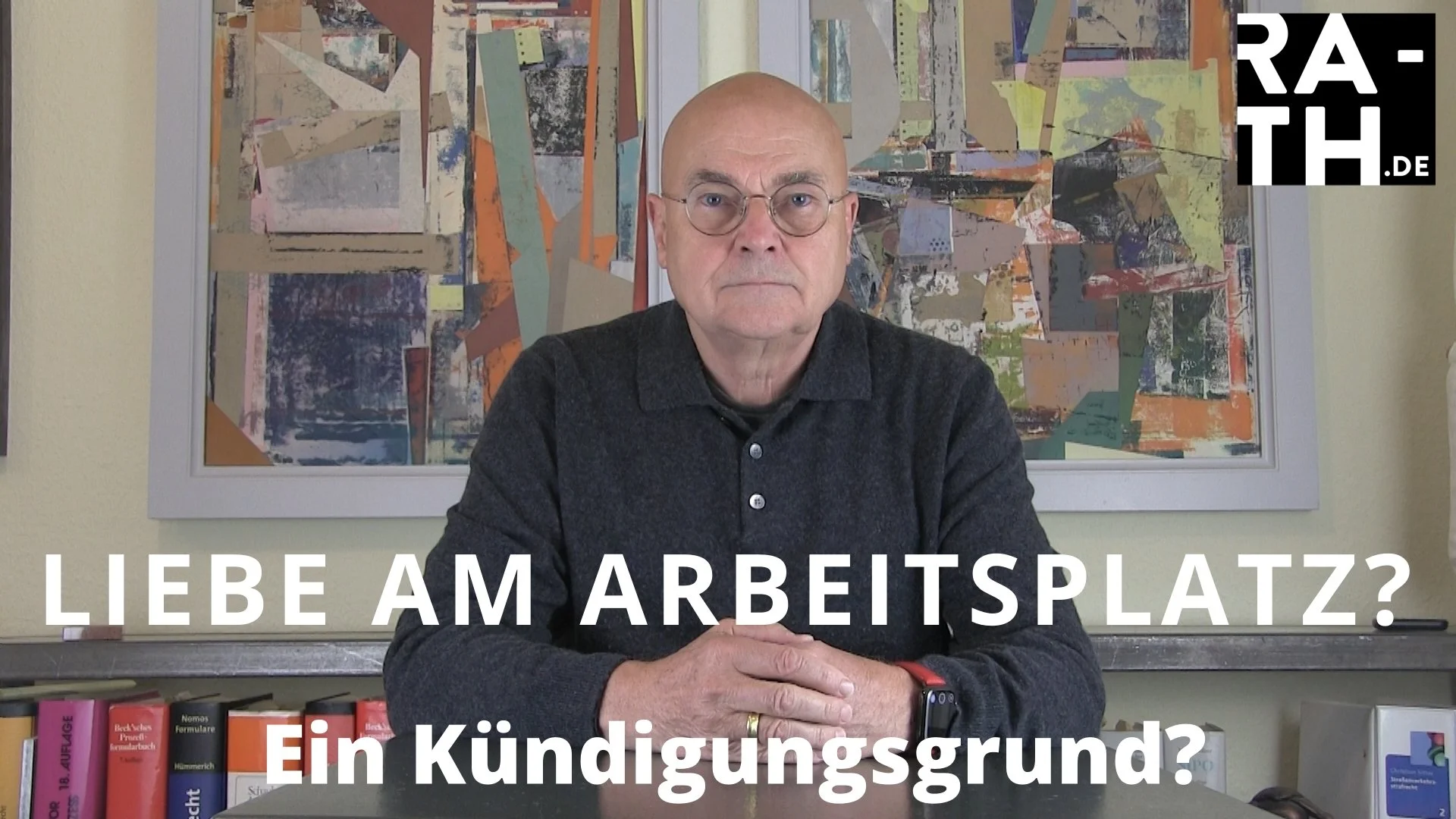LIEBE AM ARBEITSPLATZ?
Ein Kündigungsgrund?
Liebe am Arbeitsplatz: Kein Verbot – aber Führung ist gefragt
„Der CEO wurde gefeuert, weil er eine Beziehung mit einer ihm unterstellten Mitarbeiterin hatte.“ Solche Schlagzeilen aus den USA sind kein Einzelfall. Dort beenden „Codes of Conduct“ bisweilen Karrieren, wenn Beziehungen zu direkt unterstellten Mitarbeitenden nicht offengelegt oder gegen interne Richtlinien verstoßen wird.
In Deutschland stellt sich die Frage anders: Darf ein Arbeitgeber Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz verbieten? Die Antwort lautet klar: Nein. Liebe ist Privatsache – auch im Betrieb. Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf im vielzitierten „Walmart“-Beschluss unmissverständlich herausgestellt: Ein generelles Date-, Flirt- oder Beziehungsverbot verletzt Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und allgemeines Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG). Den Volltext finden Sie hier:
Volltext LAG Düsseldorf, Beschl. v. 14.11.2005 – 10 TaBV 46/05 (PDF)
Was heißt das konkret?
· Kein Generalverbot: Arbeitgeber dürfen keine pauschalen Regeln erlassen, die Beziehungen zwischen Beschäftigten generell untersagen.
· Privatsphäre geschützt: Die Anbahnung und Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen bleibt grundsätzlich Privatsache. Eingriffe sind nur in engen Grenzen zulässig.
· Mitbestimmung & Codes of Conduct: Verhaltenskodizes mit Eingriffen in das Ordnungsverhalten sind in der Regel mitbestimmungspflichtig (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). Der „Walmart“-Beschluss untersagte u. a. die Anwendung einer US-Ethikrichtlinie ohne Zustimmung des (Gesamt-)Betriebsrats.
„Liebe ist Privatsache“ – und trotzdem Chefsache
Liebe und Arbeit sind ein kompliziertes Paar. In kleineren und mittleren Betrieben kennt man sich, Dynamiken machen sich im Team so gut wie immer bemerkbar – von schmachtender Unaufmerksamkeit bis zu echtem Leistungsabfall; später vielleicht Eifersucht, Lagerbildung, Konflikte. Genau deshalb gilt: Verbieten geht nicht, hinschauen ist Pflicht.
Wo die Eingriffsschwelle liegt
Eingreifen darf der Arbeitgeber erst, wenn konkrete Störungen auftreten oder drohen – etwa bei:
· Leistung (z. B. deutlicher Produktivitätsabfall),
· Teamfrieden (z. B. Konflikte, Lagerbildung),
· Compliance/Gleichbehandlung (z. B. Begünstigungen, Interessenkonflikte).
Dann kommen mildere organisatorische Maßnahmen in Betracht: Versetzung, Anpassung der Berichtswege, Entflechtung von Weisungs-/Kontrollbeziehungen – immer verhältnismäßig, transparent und dokumentiert. Kündigungen allein wegen einer Romanze sind unwirksam; arbeitsrechtliche Schritte setzen stets konkretes Fehlverhalten oder Störungen voraus.
Besonders sensibel: Beziehungen über Hierarchien hinweg
Auch Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Untergebenen sind nicht per se verboten. Aber: Das Risiko für Interessenkonflikte und Ungleichbehandlung ist objektiv höher. Hier darf der Arbeitgeber präventiv organisieren – nicht die Beziehung verbieten, sondern Abhängigkeiten entschärfen (z. B. keine Personalentscheidungen über den Beziehungspartner, Second-Pair-of-Eyes-Prinzip, Anpassung der Reporting-Line).
Praktische Leitlinien für die Unternehmenspraxis
1) Klare, schlanke Policies statt pauschaler Verbote
- Zulässig: Regeln gegen Begünstigungen, Interessenkonflikte und Belästigung; organisatorische Maßnahmen zur Wahrung von Gleichbehandlung.
- Unzulässig: Generalverbote von Beziehungen oder „Flirt-Verbot“.
- Mitbestimmung beachten (Betriebsrat), wenn das Ordnungsverhalten betroffen ist.
2) Diskrete Offenlegungs-/Transparenzmechanismen bei Abhängigkeiten
Eine vorsichtige Regel kann sein: Führungskräfte informieren die nächst höhere Stelle vertraulich, wenn eine intime Beziehung in ihrem Weisungsbereich entsteht. Ziel: Interessenkonflikte vermeiden, nicht Privates kontrollieren. Die Ausgestaltung muss verhältnismäßig, zweckgebunden und datenschutzfest sein.
3) Früh kommunizieren, Eskalationen vermeiden
Frühe, wertschätzende Gespräche (ggf. mit beiden Beteiligten) helfen, Arbeitsorganisation anzupassen, bevor Konflikte das Team erfassen.
4) Dokumentation & Gleichbehandlung
Entscheidungen (z. B. Umsetzungen/Versetzungen) sachlich begründen und einheitlich handhaben – das schützt vor Diskriminierungsvorwürfen.
5) Schulung von Führungskräften
Führungskräfte sollten die Grenzen kennen: Keine neugierigen Nachfragen zum Privatleben; klare Reaktion bei Störungen oder Beschwerden.
Kurzfazit
· Liebe am Arbeitsplatz ist erlaubt.
· Pauschale Verbote sind unzulässig.
· Arbeitgeber handeln rechtssicher, wenn sie konkrete Störungen adressieren und Interessenkonflikte organisatorisch vermeiden – gerade bei Hierarchiebeziehungen.
· Führung ist gefragt: Hinschauen, moderieren, fair organisieren.